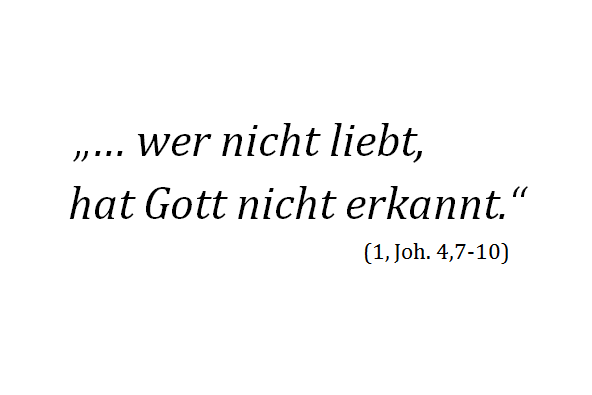Ein Kleinod ist es. Nichts Großes eben. Nur ein Glas Kaffee. Am Nachmittag.
Gerade eben erlebe ich sie wieder, diese wunderbare Entspannung, wenn in meiner puppenhaft minimalistischen Kaffeemaschine die schwarze Flüssigkeit zu brodeln beginnt. Das ist eine Sinnesfreude auf allen Ebenen. Vor allem der Riechnerv jubelt und blitzt Heilsversprechungen in die Schaltzentrale.
Viele meiner Freunde und Bekannten machen sich lustig über die Ein-Tassen-Variante meines pseudoitalienischen Espressokochers. Einerseits, weil er ob seiner herzigen Kleinheit durchaus als Kinderspielzeug durchgehen könnte. Des Weiteren, weil der schwarze Kunststoffgriff bereits abgeschmort ist und das arme Wesen nun also kupiert seinen Dienst verrichten muss. Deshalb kann ich es auch nicht mehr direkt angreifen. Es muss mit einem scheinbar überdimensionalen Topflappen gefasst werden, der das Ding zusätzlich lächerlich macht. Und schließlich ist es meine Angewohnheit, von einer Kaffee-„Maschine“ zu sprechen. Dabei hat mein 7-Euro-No-Name-Schatz ganz und gar nichts Maschinenhaftes. Wie man weiß, funktioniert es ganz ohne komplizierte Technik oder Mechanik, und vor allem nicht auf Knopfdruck. Das mag ich.
Dabei war es nicht einmal Liebe auf den ersten Blick. Es war eher eine Notwendigkeit, ein notwendiges Übel, auf eine andere Herstellungsart umzusteigen, denn ich wollte – aus umweltbedingten Überlegungen – meine kaputte Kapsel-Dingsda-Maschine nicht mehr ersetzen. Und dann war eines Tages, schnell im Vorbeigehen, das Ding gekauft.
Ich hadere, das muss ich einräumen, mit der Diskrepanz zwischen der Mini-Bodenfläche in Relation zu meiner kleinsten Herdplatte, da ist wohl viel zu viel Strom am Werk. Leider habe ich für dieses Problem noch keine Lösung.
Nichtsdestotrotz darf sie schnaufen, spritzen, brodeln, zuweilen auch schießen, wenn ein Wassertropfen explosionsartig unter der Stellfläche hervordampft.
Dieses schwarze Konzentrat, das sich nach magischer Verwandlung schließlich springbrunnenartig in die zweite Etage ergießt, befriedet mich, ja, es macht mich glücklich.
Und ich mag es auch, dass es für die Zubereitung einer gewissen Sorgfalt und Aufmerksamkeit bedarf: das Schlückchen Wasser in der unteren Kammer darf nicht zu hoch eingefüllt werden, sodass das Ventil frei bleibt. Die Bohne muss frisch gemahlen werden, bevor das feine Pulver in den Siebeinsatz gestrichen wird. Fertig gemahlener Kaffee kommt mir nicht in die Tüte. Milch will aufgeschäumt werden. Und schließlich braucht es Zeit, bis meine kleine Freundin ihre Arbeit zu Ende gebracht hat. Zeit, die ich mir so gerne nehme, um schlussendlich wohlig und zufrieden auf meiner Entspannungsinsel zu sitzen. Mit meinem Kaffee. Im Glas.
Und solange ich diese Ausflüge hinkriege, holt mich kein Burnout ein.
Anm. d. Autorin: Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Textes saß ich noch nicht auf der Corona-Isolationsinsel. Doch auch hier tut’s gut, das Glas.
 Mag. Susi Radman hat das Studium der Romanistik absolviert.
Mag. Susi Radman hat das Studium der Romanistik absolviert.
Sie arbeitet, nach langjähriger Unterrichtstätigkeit in Schüler- und
Erwachsenenbildung, als Therapeutin und Pädagogin vorwiegend mit Kindern.