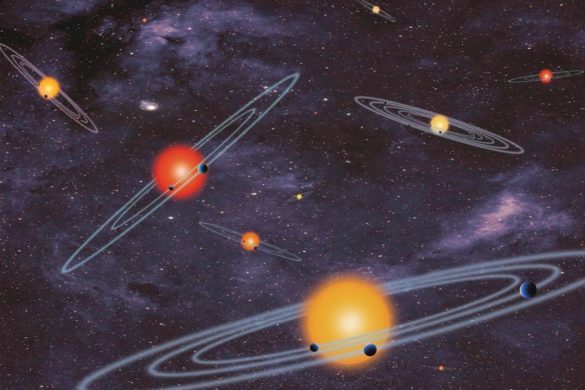Man versteht das Heute nur, indem man von gestern weiß.
Andreas Kirchner: Sie sind zweifelsfrei eine weit gereiste Frau. Geboren 1927 in Dresden, sind dann über Reichenberg, Böhmen und wieder über Dresden nach Wien gezogen.
Freda Meissner-Blau: Nicht über Dresden. Quer durch das brennende Deutschland. Das war 1945. Dresden war ein reiner Zufall, ich wollte gar nicht nach Dresden, ich wollte in den Westen. Die Sowjettruppen haben damals Breslau umzingelt. Und als der Verteidigungskreis von Breslau brach, war es für mich völlig logisch, dass ich nach Südwesten weitermarschieren werde. Ich lebte damals in Reichenberg, heute Liberec, und wir sind 1941 aufgrund der politischen Einstellung meines Vaters, der deswegen nach England emigriert war, von Wien zurück in die Heimat meiner Mutter gezogen und haben in Nordböhmen gelebt. Und wie gesagt, als das Desaster passierte und die Sowjettruppen durchgebrochen sind, habe ich zu meiner Mutter gesagt, dass wir flüchten müssen. Zu dieser Zeit waren die Flüchtlingstracks aus dem Osten schon seit Monaten unterwegs. Sie meinte nein, nur die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Und ich hatte Angst. Ich hatte zu Recht Angst. In den ersten Wochen wurde die Bevölkerung für Plünderung, Gewalt freigegeben. Ich bin als eine der letzten, ich glaube am 11. Februar, losgezogen und konnte noch in einen der letzten Züge einsteigen, was ein Sonderprivileg war, denn die Züge waren für die Wehrmacht und die Flüchtlingstracks gesperrt. Normale Zivilisten, obwohl ich dann auch schon ein Flüchtling war, durften gar nicht hinein, und ich kam noch hinein. (Unterbrechung durch Telefonat) Kurz vor Dresden fiel eine Bombe, das war der Anfang des anglo-amerikanischen Angriffs, der drei Tage gedauert hat. (Unterbrechung durch Telefonat) Kurz vor Dresden fiel die Bombe auf die Gleise. Es war ja alles verdunkelt und wir mussten alle raus aus dem Zug. Die Geschichte, die dann folgte, erspare ich ihnen jetzt, aber ab diesem Zeitpunkt war ich richtiger Flüchtling, bin bis nach Jena gekommen. Dort war dann alles aus. Bei der Bombardierung von Jena bin ich auf den Hügel gegangen und war dadurch nicht in Gefahr. Diese Bombardierung hat zwei Nächte und drei Tage gedauert, das war eine schreckliche Erfahrung. Bis dahin war ich relativ behütet, aber da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben die Leichen auf den Straßen gesehen. Erwachsene Männer, die von den Phosphorbomben auf Säuglingsgröße geschrumpft waren. Das hat einen solchen Schock in mir ausgelöst, dass ich mir gesagt habe, das dürfen Menschen nie wieder Menschen antun, so etwas darf nie wieder passieren. Jahre später hat mich das in die Friedensbewegung gebracht. Das meine ich im Buch, wenn ich mir mein Leben, das sehr bunt und aufregend wirkt, nicht unbedingt ausgesucht habe. Ich war durch die Ereignisse gezwungen, einen bestimmten Weg zu gehen, denn ab dann bin ich durch das ganze brennende Deutschland geflüchtet. Viele Strecken zu Fuß. Nach Monaten bin ich in Nürnberg gelandet und habe dort versucht, irgendwo Fuß zu fassen, war aber eigentlich mit dem Überleben beschäftigt.
Das heißt, Sie sind sehr viel gereist in Ihrem Leben. Gewollt und ungewollt. Sind aber dann doch wieder in Wien gelandet.
Na klar, die Nostalgie, die Sehnsucht nach Wien. Ich bin hier aufgewachsen. So komisch das klingt, aber für mich war Wien immer der Ort des Friedens. Auch des persönlichen. Ich bin immer wieder zurück. Ich habe längere Zeit in Frankreich, im Kongo gelebt. Das war eine interessante Zeit, und doch immer wieder nach Wien gekommen. Und endgültig dann 1972.
Es war eine Rückkehr für Sie.
Das war eine totale Rückkehr mit Sack und Pack und Kindern.
Sie haben, wie schon erwähnt, mehrere Jahre in Frankreich gelebt und dort in Paris gearbeitet. Wie sehen Sie den Anschlag auf die Mitarbeiter des Satire Magazins Charlie Hebdo?
Das ist für mich ein ganz herber Schlag. Nicht nur, weil ich die Zeitung monatelang gelesen habe, die Leute kenne mit ihrer Mentalität, unter denen übrigens auch sehr viele Grüne sind. Sondern auch, weil es ein furchtbarer Bruch in unserer ganzen Gesellschaft ist. Ein Bruch, der die Rechtsradikalität droht zu verstärken und wirklich eine Spaltung der Gesellschaft stattfindet. Die Reaktion in Frankreich ist so empört und verzweifelt, wie sie nur sein kann. Charlie Hebdo wird unterstützt, dass es jetzt weiter geht. Dieses Gefühl, wieder vereint zu sein, sei es unter Trauer, unter Leid, unter Empörung, hilft, dass sie zusammenstehen und sich der Gefahr von rechts besser bewusst werden, die auch in Frankreich sehr groß ist. Das ist natürlich Wasser auf den Mühlen der Rechten. Meiner Meinung ist es total verfehlt, dass man jetzt sagt, die Muslims müssen sich an unserer Sorte von Karikaturen, Witz und Ikonoklasmen gewöhnen. Sie können es nicht, solange sie sich selbst beleidigt fühlen. Ich habe einen intellektuellen marokkanischen Freund in Paris, der absolut kein gläubiger Moslem ist, aber seine Brüder versteht. Für die sei das so schrecklich, die empfinden das nicht nur als Beleidigung von Mohammed, sondern es ist ihre Seele, die beleidigt wird. Man müsste sich mit Muslimen zusammensetzen und denen erklären, wie wir das sehen. Dass wir ihre Haltung durchaus als ihre Haltung respektieren, aber es kann nicht unsere sein. Dass man auf eine Vereinbarung kommt, dass man sich gegenseitig akzeptiert und es nicht so persönlich nimmt. In dieser Richtung geschieht nichts, es wird nur eskaliert. Ich verstehe, dass sie in Paris schreckliche Wut haben, dennoch frage ich mich, das Entscheidende ist doch, dass man verbindet, wenn jemand verletzt ist. Es ist aber kein Schritt in Richtung dieser Verbindlichkeit da. Das macht mich sehr besorgt, weil die Eskalation evident ist. Auch für uns im kleinen verschlafenen Österreich hat es Auswirkungen. Deutschland muss sich fürchten, England muss sich fürchten, wir müssen uns weniger fürchten, weil wir so unwichtig sind. Gott sei Dank sind wir unwichtig, kann ich nur sagen. Das ist das erste Mal, dass ich froh bin, dass wir nicht teilnehmen an den Dingen, an denen wir wohl teilnehmen sollten. Die Zukunftsaussichten sind nicht sehr berauschend.
Es gibt eine Reihe von Politikern, die versuchen aus dem Anschlag Kapital zu gewinnen.
Ja, natürlich, die kennen wir ja. Das Böse hat Namen und Adresse, und ich habe sie immer gerne genannt.
Möchten Sie jetzt wen nennen?
Bei uns ist es natürlich diese ganze lächerliche Strache-Partie, die natürlich jetzt jubelt. Sie können nur jubeln, wenn sie auch vorgeben, nicht zu jubeln. Die Möglichkeit einer großen Verstärkung in der nächsten Wahl dieser ganz rechten Gesellschaft ist sehr wahrscheinlich. Ich fürchte mich nicht vor ihnen, weil sie unfähig sind. Sie werden so schnell scheitern, wie die Schüssel-Blauen gescheitert sind. Dann werden wir alle sechs Wochen einen neuen Minister haben, nur haben die keine Personalreserve. Ich fürchte mich keine Minute.
In den späten 40er Jahren haben Sie in Wien ein Publizistik und Journalismus Studium begonnen. Haben Sie von der journalistischen Arbeit und Ihrem Studium später in der Politik profitiert?
Ja, das würde ich schon sagen. Ich war mein Leben lang eine Politikbeobachterin, bis ich selbst einmal einen konkreten Ausflug in die Politik gemacht habe. Dies hat sich auch wieder durch die Umstände ergeben. Es hat mir viel gebracht und ich habe auch sehr viel geschrieben. Es liegen alleine in Österreich über 500 Artikel von mir herum. Das Schreiben ist mir immer nahe gewesen, leicht gefallen.
Bei der Präsentation Ihres Buches „Die Frage bleibt“ haben Sie für die Freiheit und Selbstentscheidung jedes einzelnen Menschen plädiert. Die Grünen haben in einigen Medien den Ruf der Verbotspartei bekommen.
Eigentlich möchte ich dazu gar keine Stellung nehmen.
Vielleicht darf ich trotzdem eine Nachfrage stellen?
Ja, tun Sie.
Können Sie verstehen, dass es Menschen ärgert, wenn manche Grüne die Höchstgeschwindigkeit reduzieren wollen?
Das finde ich sehr klug von ihnen. Also da stehe ich wirklich hinter ihnen. Das habe ich heute auf eigenem Leib gespürt. Mit einem Affenzahn hat mich der aufgespießt. Das dürfte nicht sein. Nicht nur wegen meiner persönlichen Geschichte, sondern prinzipiell. Ersparnis von Leid, von Toten, von Verletzten und von Umweltverschmutzung. Es wird die Menschen weniger zappelig machen. Wir alle fühlen uns gehetzt, und diese immer rasanter Fahren hinterlässt auch Spuren in der ganzen Haltung zueinander. Und ich muss sagen, im Straßenverehr geht es schon recht grauslich zu. Auch das habe ich heute erfahren, wo einer aus dem Auto steigt, nachdem er mich anfährt, um mich zu beschimpfen. Ein Doktor irgendwas, ein doch zumindest halbgebildeter Akademiker. Das ist doch erstaunlich.
Glauben Sie grundsätzlich, dass Gebote, Verbote und Regeln eine Gesellschaft besser machen?
Nein, nicht generell. Ich bin eine, die die Selbstverantwortung des Menschen förderlich sieht. Verbote, die sinnführend sind, die Menschen helfen, ich glaube, diese würde ich immer unterstützen. Das heißt ja nicht, dass ich eine Verbotsgesellschaft haben will. Verbote machen nur ganz spezifisch Sinn. Ein Rauchverbot in öffentlichen Räumen, seitdem nachgewiesen ist, dass das Mitrauchen von Nichtrauchern auch sehr schädlich ist, finde ich auch in Ordnung. Wenn es bei den angeblich undisziplinierten Italienern funktioniert, sehe ich nicht ein, dass es bei uns nicht funktionieren soll. Und zwar, weil es eine Belästigung für Dritte ist. Da sind Verbote gerecht. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre ich dagegen. Nützliche Verbote, dagegen kann man nicht sein, wenn man wirklich die Vorteile und Nachteile gegeneinander aufwiegt.
Weil Sie das Rauchen ansprechen – es wird momentan die Legalisierung von Cannabis diskutiert.
Ja, bin ich auch dafür. Bin ich absolut dafür. Das ist sinnvoll. Erst einmal ist Cannabis ein Schmerzmittel. Es soll als solches endlich eingesetzt werden.
Wird es teilweise.
Von klugen Ärzten, die etwas für sich riskieren dabei. Ich bewundere die sehr dafür. Noch nicht genug und noch nicht in öffentlichen Krankenhäusern. Da könnte noch eine große Öffnung passieren. Aber auch generell. In Österreich hat der Alkoholismus Tradition. Es ist fesch, b’soffen zu sein, scheinbar. Wenn der Alkoholismus etwas zurückgedrängt werden würde, wäre mir das ganz recht. Das zerstört ganze Familien. Cannabis hat noch nie eine Familie zerstört. Nicht, dass ich wüsste.
Und es gab nachweislich auch noch keinen Todesfall durch Cannabis.
Ja, richtig.
Ein Sprung in die Vergangenheit. Sie haben 1986 für die Bundespräsidentschaft kandidiert. Mit 5,5 % sind Sie Kurt Waldheim von der ÖVP und Kurt Steyrer von der SPÖ unterlegen. Waren Sie damals enttäuscht?
Jein. Doch, ich war enttäuscht, weil man mir vorhergesagt hat, dass ich etwa 8 Prozent haben werde. Dann brach der Waldheim-Skandal auf und da haben mir sozialistische… sozialdemokratische Freunde – sozialistisch darf man nicht mehr sagen, das ist ja schon wieder anrüchig – gesagt, sie hätten so gern für mich und die grüne Idee gestimmt, aber jetzt können sie ihren Kurtl Steyrer nicht hängen lassen, das verstehst du doch. Und ich habe es zähneknirschend verstanden. In der ÖVP war es dasselbe. Die liberaleren ÖVPler haben gesagt, sie würden mich wählen, obwohl ich für die verstaatlichte Industrie eintrete, aber jetzt müssen wir Waldheim unterstützen. Dadurch bin ich von den acht Prozent auf die fünfeinhalb Prozent. Auf der anderen Seite hat mich der damalige Außenminister Dr. Mock gefragt, wie ich das ohne Geld, ohne Werbung, ohne Fotos gemacht habe. Nichts war da, und auf einen Hopps fünfeinhalb Prozent, das ist doch phänomenal. Und da habe ich erst kapiert, dass das gar nicht so schlecht ist. Ich war in der Eitelkeit, die ich in meinem Narzissmus auch habe, ein bisschen gekränkt, dass es nicht acht Prozent waren. Zehn Prozent wären mir noch lieber gewesen, aber das hat es nicht gespielt. Ich hatte ja niemanden hinter mir, außer ein paar intellektuellen Journalisten, Philosophen und Wissenschaftlern. Wir waren ja nur ein Komitee und keine Partei. Soweit ich weiß, war das das erste Mal in Österreich, dass jemand kandidiert hat, ohne eine Partei im Rücken zu haben.
Es hat auch keine großzügigen Finanziers gegeben?
Nein, nichts. Es waren fünf Schilling Spenden für mich. Deswegen haben wir auch kaum irgendwelche Werbung machen können. Ich bin mutterseelenallein am Stephansplatz gestanden und habe Zetteln verteilt, warum ich kandidiere, warum ich mir das antue.
Jetzt, 28 Jahre später, ist der ehemalige Obmann der Grünen, Alexander Van der Bellen, wieder im Gespräch für Bundespräsidentschaftswahl 2016 und hat laut aktuellen Umfragen relativ gute Chancen.
Ja, ich gebe ihm gute Chancen.
Das heißt, Sie sehen das mögliche Antreten als durchaus sinnvoll?
Ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage, aber er ist sicher ein bisschen mehr als ein Zählkandidat. In dieser Notsituation – wir wissen ja noch nicht, wen die anderen zwei vorschlagen, insofern ist es schwer mit einiger Gewissheit vorauszusagen, aber prinzipiell hat er Chancen. Er ist beliebt, er ist sehr verbindlich und liebenswürdig und spricht einen professoralen Jargon, so dass ihn jeder versteht, und nicht in Politiker-Luftblasen. Das macht ihn für viele Menschen sympathisch.
Würden Sie ihn wählen?
Das kann ich nicht sagen, bevor ich nicht weiß, wer kandidiert. Ich würde einmal vorsichtig sagen, ich könnte es mir prinzipiell vorstellen. Wenn nichts Gescheiteres kommt, dann werde ich ihn sicher wählen, aus Mangel an anderen Möglichkeiten.
Im Umkehrschluss ist die Möglichkeit schon gegeben, dass SPÖ und ÖVP Kandidaten hätten, die Sie ansprechen würden?
Ich kenne keine, ehrlich gesagt. (lacht) Aber Wunder passieren. Ich schaue mir das erst einmal an und entscheide nichts, bevor ich nicht hinkomme. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Van der Bellen ist ein respektabler Kandidat.
Bei öffentlichen Auftritten von einigen Politikern merkt man, dass sie immer wieder dieselben Phrasen verwenden. Finde Sie diesen verkrampften Polit-Sprech nicht auch nervend?
Ja, da bin ich völlig ihrer Meinung. Die verkrampften Politiker werden von irgendwelchen Instituten geschult, wie sie recht unnatürlich reden und vorwiegend nur ihre Stehsätze loslassen. Man hat das Gefühl, sie sind als Mensch überhaupt nicht dabei. Ich muss sagen, ich war in der Assemblée nationale in Frankreich, ich war im House of Commons in England eingeladen. Na, da geht es anders zu. Da brüllen sie sich an, ich habe mir sagen lassen, dass es zu Tätlichkeiten in Great Brighton kommt, aber man hat das Gefühl, da sind Menschen, die kämpfen für ihre Sache. Meistens für ihre Partei, manchmal aber auch für eine Sache. Das ist mir schon lieber, wenn es eine faire Auseinandersetzung gibt, eine Konfrontation und nicht ein Gemauschel wie bei uns, dass man Konflikte austrägt und nicht zudeckt und dann eine schwierige, österreichische Lösung findet. So alt wie ich bin, glaube ich immer noch, dass das besser ist. In Deutschland hat man das Gefühl, sind die Auseinandersetzungen lebhafter und nicht vorwiegend denunzierend. Das hat mir in der Politik furchtbar missfallen und ich hatte auch nach zwei Jahren genug.
Das war dann auch der Grund…
Das habe ich auch bei meiner Abschiedpressekonferenz sehr ehrlich gesagt. Ich habe gesagt, die wichtigen Entscheidungen werden nicht im Parlament gefällt, und ich will nicht als Alibidemokratin hier eine Rolle spielen, da gehe ich lieber zurück in die Graswurzelbewegung. Da habe ich das Gefühl, es bewegt sich etwas. Nie hätten wir Zwentendorf im Parlament verhindern können. Wir hätten heute sechs Atomkraftwerke in Österreich. Da bin ich schon froh, dass die Menschen in Österreich die Intelligenz hatten, dieser Art der Technologie, die riskant, zu teuer und gefährlich ist, eine Absage zu erteilen. Dieser Volksaufstand damals heilte viele Wunden, die man bekommt.
Sie haben Ihr Leben lang für die Rechte der Frauen gekämpft – wie sehen Sie den heutigen Feminismus?
Das ist jetzt ein sehr heikles Gebiet geworden. Auch da bin ich Graswurzel. Ich kann auf die Straße gehen und sagen, was ich denke und Leute animieren mitzumachen. Diese Frauenbewegung, wie ich sie aus Frankreich und Amerika kennen – und auch in Ansätzen in Österreich, wo auch sofort der persönliche Hick Hack ausgebrochen ist – die hat sich grundsätzlich gewandelt. Es gibt keine Frauenbewegung, die irgendwie kanalisiert ist. Das hat sich jetzt in die Universitäten verlagert. Mich freut, dass Frauengeschichte und Frauenbefreiungsgeschichte aufgearbeitet wird. Es ist auch gut, dass unsere eigene Geschichte beleuchtet wird. Das ist prima, aber es ist sehr verwissenschaftlicht. Im Mai 1968 habe ich in einer französischen Frauengruppe mitarbeiten dürfen. Hauptsächlich habe ich dort geschwiegen, was sonst nicht mein Stil ist, aber ich bin intellektuell einfach nicht mitgekommen. Das waren alles Psychoanalytikerinnen, sehr kluge Frauen. Die Psyche spielte eine große Rolle und die Politik war sehr scharf. Es gibt Bücher von Irigaray (Anm.: Luce, französische Psychoanalytikerin), die auch für mich, als doch einigermaßen halb-, dreiviertelgebildete, kaum zu verstehen sind. Das hilft natürlich der breiteren Frauenbewegung nicht, obwohl es wissenschaftlich interessant ist. Die Frauenbewegung hat sich ein bisschen in das wissenschaftliche Eck zurückgezogen, wenn ich das so vorsichtig sagen kann. Was nicht heißt, dass es nicht zwischen der Zeit des wirklichen feministischen Aktivismus, den ich in Frankreich miterlebt habe, und jetzt, ein breiteres Bewusstseinsniveau entstanden ist. Es ist nur leider noch nicht bis ganz nach unten durchgedrungen. Aber auch Arbeiterfrauen lassen sich nicht mehr ganz so viel gefallen. Schlimm ist natürlich die wirtschaftliche Verengung, die wir erleben, dass die Frauen sich wieder von Männern abhängig machen. Das ist wie eine Wellenbewegung, die ich hier sehe.
Wäre es nicht viel wichtiger gegen so etwas zu kämpfen? Bei manchen Feministinnen hat man den Eindruck, sie kämpfen hauptsächlich für die gegenderte Schreibweise, das heißt dass sich die männliche und die weibliche Form in der Schrift und Sprache wiederfinden. Zumindest wird es medial so transportiert. Was sagen Sie dazu? Wirkt das nicht schon fast lächerlich?
Finde ich gar nicht. Als Frau finde ich das nicht lächerlich. Ich finde es berechtigt, dass klar gemacht wird, dass es nicht nur Männer auf der Welt gibt. Das ist eine Bewusstseinsfrage, wenn ich sage Frauen und Männer, dann ist in meinem Gehirn etwas passiert. „Man“ und „frau“ macht.
Sagen Sie es so?
Nein. Nein, das ist mir zu umständlich. Aber ich mache schon klar in meiner Sprache, dass ich meine Geschlechtsgenossinnen wertvoll, wenn nicht sogar in manchen Beziehungen wertvoller sehe und genauso tüchtig, nur haben sie es bisher noch nicht so praktizieren können. Wissen Sie, für mich ist das die größte Revolution, die im 20. Jahrhundert stattgefunden hat. Ich bin in einer eher patriarchalischen Familie in Linz aufgewachsen, und alle Menschen, die irgendwie wichtig waren – ob das der Kinderarzt, der Professor, in der Musikschule, der Papa – das waren alles Männer. Und nirgends saß eine Frau. Ich bin mit dieser Einseitigkeit aufgewachsen und für mich ist das, was erreicht wurde, phänomenal. Und wenn ich meine Tochter anschaue, die steht auf meinen Schultern, die hat so viel mitgekriegt. Die hat diese Probleme gar nicht. Ich würde sie auch eher als Feministin bezeichnen, aber nicht so bewusst, wie ich. Für sie ist es so natürlich, dass sie einen guten Job macht, dass sie Fantasie hat, dass sie ihr Leben und das ihres Kindes in die Hand nimmt. Ich bin ja nicht so pessimistisch, was die Frauenfrage betrifft. Sie müssen weiterkämpfen, okay. In der heutigen Zeit gibt es so viele Dramen, die uns unter die Haut gehen und die zukunftsentscheidend sind, dass ich mich mehr für die interessiere, als für die Frage Männlein oder Weiblein. Bei Greenpeace sind Männer und Frauen auf einem Niveau, sie sind ein und dasselbe. Und beide sind tapfer, und beide werden geschnappt von den Russen, und beide gehen hinter Gitter. Wo ist der Unterschied? Für mich kein großes Problem mehr. Sie nervt es, gell?
Das ist schwierig zu beantworten. Was meinen Sie jetzt konkret?
Mit dem feministischen Wunsch auch als Frau in der Schrift und in der Sprache zu erscheinen.
Nein, nerven nicht, aber ich denke, dass es durchaus noch andere Notwendigkeiten gibt, in die man die Energie investieren sollte. Wie zum Beispiel gleicher Lohn für gleiche Arbeit für beide Geschlechter. Ich merke, dass gerade das Gendern medial sehr ausgeschlachtet wird und den anderen Bereichen sehr wenig Platz gegeben wird, wovon ich denke, die wären noch viel wichtiger zu diskutieren.
Wobei die ganze Genderfrage – das können wir jetzt nicht ausdiskutieren – eine etwas mit Vorsicht zu genießende Geschichte ist. Soweit gebe ich Ihnen Recht. Dieses absolut auf Gendering bestehen. Ich muss Ihnen sagen, in der Friedensbewegung habe ich mindestens so viele Frauen wie Männer kennengelernt. Wir haben eine Kette von Stuttgart bis München seinerzeit gegen die Aufstellung der Pershing [Anm.: eine Rakete aus der Zeit des Kalten Krieges aus US-amerikanischer Produktion] gebildet. Ich frage mich, ob da nicht mehr Frauen waren als Männer. Durchaus möglich. Frauen sind auch sehr engagiert in anderen Dingen, die sind nicht nur auf die Genderfrage reduziert.
Aber es wird medial oft so transportiert. Und ich möchte schon klarstellen, rein der Feminismus, der Kampf für Frauenrechte, nervt mich nicht.
Ist das nicht auch eine mediale Frage?
Wäre interessant, warum.
Das verstehen die Journalisten. (lacht) Als bisher meistens Männer – das hat sich ja profund … darf ich? (schenkt Tee nach) – das hat sich ja profund geändert. Es gibt ja sehr viele brauchbare, gute Journalistinnen.
Würden Sie einem jungen Menschen raten, in die Politik zu gehen, wenn er etwas verändern will?
Wenn er daran interessiert ist und etwas verändern will, ja. Aber ich würde erwarten, dass er die Geschichte kennt, damit er weiß, warum wir dort sind, wie wir geworden sind. Das ist mir sehr wichtig. Ich erlebe auch bei Journalisten, notabene, wenn sie nicht gerade Historikerinnen und Historiker sind, eine Ahistorizität, die mir nicht gefällt. Man versteht das Heute nur, indem man von gestern weiß. Gerade die Zeitgeschichte von 1848 bis jetzt in Österreich ist so wichtig, da versteht man viel mehr. Wenn er sich dem unterzieht und ein Weltbild hat und intelligent ist, dann würde ich dem jungen Menschen – wieder Männlein wie Weiblein – raten, nicht mit allzu großen Erwartungen in die Politik zu gehen. Ich habe schon junge Menschen hier gehabt und habe denen gesagt, sie sollen nicht in die Politik gehen, die so offensichtlich nur ins Parlament wollten. Im Parlament passieren nicht die Sachen. Da hat man eine gute Bühne, das ist auch nicht unwichtig, aber das ist nicht alles. Man trifft dort lange keine Entscheidungen, sie müssen ja die Mehrheit haben.
Das heißt ja, aber keine Parteipolitik.
So ist es.
Sie führten neben Gerhard Oberschlick den Vorsitz des ersten internationalen Menschenrechtstribunals in Wien, wobei eine Reihe von Menschenrechtsorganisationen symbolisch Anklage wegen der Verfolgung und Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen in Österreich zwischen 1945 und 1995 gegen die Republik Österreich erhoben hat. Was hat sich seit 1995 getan?
Mir ist es ja immer ein Rätsel, dass sowohl Lesben, wie auch schwule Männer unbedingt in der Kirche heiraten wollen. Die Kirche, die sie geschmäht hat, die sie beleidigt hat, die die letzten 200, 300 Jahre fürs Schwulsein getötet hat, und jetzt wollen sie nichts lieber. Das ist mir ein Rätsel. Ich würde ablehnen in der Kirche zu heiraten, wäre ich eine Lesbe. Das verstehe ich nicht, dazu kann ich nichts sagen. Generell würde ich sagen, Österreich hinkt hinten nach. Wie so oft, sind wir zehn Jahre dahinter. Ich war eine der ersten im Parlament, die sich seinerzeit der Frage angenommen hat, aber auch da kann ich mich nicht wahnsinnig über die Ungerechtigkeiten alterieren. Das wird alles kommen, es ist auf dem besten Weg. Sie werden alles kriegen, was sie wollen, weil das der Trend der Zeit ist und Österreich sich nicht ins Winkerl stellen kann. Auch wenn es die ÖVP möchte. Ich glaube nicht, dass es durchführbar ist, das Österreich nicht alle Menschenrechte voll erfüllt.
Sehen Sie Conchita Wursts Song Contest Sieg als einen Schritt in die richtige Richtung?
Aber natürlich. Aber ich bin nicht aufgeregt über die Frage. Schon längst nicht mehr. Es treibt mich nicht mehr um.
Als Vorreiterin in so vielen Bereichen sind Sie Vorbild für viele Menschen. Haben Sie ein Vorbild? Oder relativiert sich die Sicht auf Vorbilder im Alter?
Ich habe einige Vorbilder. Und zwar in meiner näheren Umgebung war mein Mann [Anm.: Paul Blau] ein Vorbild. Ein Vorbild von Toleranz, Friedfertigkeit und einer Weltsicht, mit der ich konform war. Ich habe noch andere Vorbilder und schreibe auch darüber. Ivan Illich [Anm.: austroamerikanischer Philosoph, Autor und Theologe] war ein intellektuelles Vorbild, auch Paul Lazarsfeld [Anm. austroamerikanische Soziologe] war ein intellektuelles Vorbild. Mit Robert Jung waren mein Mann und ich sehr gut befreundet. Er war in seinem unendlichen Optimismus über das Gute im Menschen ein Vorbild, denn ich bin da viel skeptischer. Eine ganze Reihe Vorbilder. Zugegebenerweise – und das kommt natürlich aus meiner Entwicklung, aus meiner Jugend – viel weniger Frauen. Ich kann nicht sagen, dass Simone de Beauvoir [Anm.: franz. Schriftstellerin, Philosophin und Feministin] ein Vorbild für mich war. Ja, es gab auch natürlich Frauen, die vorbildhaft gewirkt haben. Margarete Mitscherlich [dt. Psychoanalytiker, Ärztin und Autorin] habe ich gekannt und die hat mir seinerzeit sehr imponiert, aber ich würde nicht sagen, dass sie ein Vorbild war. Außerdem war ihr letztes Buch so mittelmäßig, dass ich Abstand genommen habe. (lacht)
Sie leben seit einigen Jahren mit einem Spenderherz. Stimmt es, dass Sie die Transplantation anfangs abgelehnt haben?
Jahrelang.
Warum?
Eigentlich aus sehr prinzipiellen Gründen. Weil ich die Manipulation des menschlichen Körpers an sich ablehne. Als überzeugte Umweltaktivistin muss ich sie ablehnen. Das war mir klar – ich habe ja auch ein bisschen Medizin studiert, daher kenne ich mich ein bisschen in der Anatomie und Physiologie aus – dass mit der Transplantation und der Immuntherapie Tür und Tor für weitere Manipulationen, die schon sehr weit gehen, geöffnet wird. Die Formung eines zweiten Menschen als Ersatzteillager für andere Menschen – das sind Dinge, die ich einfach nicht akzeptieren kann. Was in der Genetik jetzt schon möglich ist und was in der Biogenetik getan wird, ist einfach nicht menschenadäquat. Für mich war die Transplantation ein erster Schritt in die Richtung. Ich habe das auch den Ärzten sehr großmäulig gesagt, wenn mein Herz nicht mehr funktioniert, wenn das Organ nicht mehr mitkann, dann gehe ich eben. Wie sie mir aber acht Jahre später gesagt haben, ich habe nur mehr 14 Tage zu leben, hat die ganze Sache plötzlich anders ausgesehen. Das ist ja eigentlich eine großartige Sache. Es tut mir zwar leid, ich hätte gerne noch fünf Jahre – in der Zwischenzeit sind es 16 Jahre – ich bin sehr gut behandelt worden. Da ich bei meinem eigenen Tod nicht dabei gewesen wäre, wenn das Herz schon zu schwach gewesen wäre und ich bei der Anästhesie gestorben wäre, habe ich spontan sofort zugesagt. Die Ärzte meinten, dass ich mich schnell entscheiden muss. Morgen früh bräuchten sie ein Ja oder ein Nein. Da meinte ich, dass sie darauf nicht zu warten brauchen, ich sage jetzt ja. In der Erwartung, dass ich eh dahingehe. Und heute bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Und ich bin dankbar. Ich bin meinen Ärzten und dem Pflegepersonal unendlich dankbar. Aber das, was mit dem menschlichen Körper heute passiert, damit kann ich nicht einverstanden sein. Nicht, dass ich irgendetwas dagegen mache, ich stelle es nur für mich fest. Es ist auch nicht aufzuhalten. Alles, was möglich ist, wird gemacht. Das ist ganz bestimmt so im Leben, und das ist schade. Wir können nicht verzichten. Auf goar nix. Auch nicht auf schnell fahren. (lacht)
Jeder einzelne kann das vielleicht für sich bestimmen, oder verzichten, aber im Großen und Ganzen natürlich nicht.
So ist es. Man kann es nur für sich selbst praktizieren.
Sie haben bei einem unserer Telefonate gesagt, dass Sie den Eindruck haben, man habe Sie kurz vor Ihrem Begräbnis wiederentdeckt. Beschäftigen Sie sich mit dem Tod?
Ja, Gott sei Dank. Ich habe eine Neujahrsresolution gefasst und lebe sie auch zum Unterschied von den meisten Neujahrsresolutionen. Ich bin in der Neujahrsnacht, die eigentlich sehr hübsch war, da war ich sehr aufgekratzt und konnte gar nicht schlafen gehen und habe mich dahin gesetzt (zeigt auf die Couch) und habe ein bisschen über mein Leben nachgedacht. Es wird ja Zeit, nachzudenken. Ich habe mich mein ganzes Leben eigentlich um andere Menschen gekümmert. Kinder, Parteien, Forschungsziele, Flüchtlinge, meine Mutter, wie sie alt wurde. Dann habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn ich mich einmal um mich kümmere, diese letzten Wochen, Monate, vielleicht Jährlein. Dann habe ich mir gedacht, das mache ich. Und mache das jetzt schon – heute ist der 8. – und mache das mit viel Erfolg seit acht Tagen. Das heißt ich gehe spazieren, wenn ich es einrichten kann, ich gehe schwimmen, wenn ich es einrichten kann und das ist für mich ein neues Leben. Nicht zu sagen, ich muss jetzt das, ich muss, ich muss, ich muss. Sondern zu sagen: nein, eigentlich sage ich dort ab, da muss ich gar nicht hin, die kommen wunderbar ohne mich aus und ich gehe schwimmen.
Da ist es aber schön, dass Sie uns empfangen haben.
Ja, das freut mich auch. Junge Leute habe ich immer gerne.
Zum Abschluss dürfen Sie sich noch etwas wünschen. Für sich selbst, für die Gesellschaft oder für wen auch immer.
Da wünsche ich mir am liebsten doch etwas für die Gesellschaft. Das ist so eindeutig, dass wir zur Vernunft kommen mögen. Wir, das schließt alle Menschen ein. Sowohl die Politiker, aber von denen kommt es nicht, wir sind alle verantwortlich füreinander, das habe ich so gelernt und aufgenommen, ich glaube wir müssen wieder viel mehr Empathie miteinander haben, und das setzt so viel anderes voraus, dass es friedlicher in uns und in unserer Umgebung wird. Das wünsche ich mir natürlich.
Frau Meissner-Blau, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Gerne.